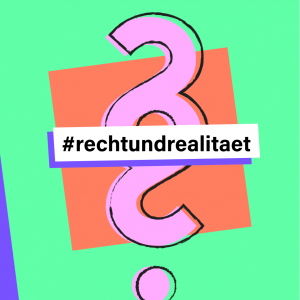Beyond the Museum
Architektur für ein neues Miteinander
Interdisziplinäres Fachsymposium der Stiftung Forum Recht
13. und 14. Juli 2022
Gebaute Räume geben Orientierung. Sie ermöglichen und strukturieren soziale Interaktion, beeinflussen, wie sich Menschen fühlen und drücken gesellschaftspolitischen Zeitgeist aus. Im vierten Symposium zum Aufbau der Stiftung Forum Recht stehen Impulse zur Architektur der zukünftigen Neubauten in Leipzig und Karlsruhe und die Frage im Fokus, wie man die Idee für eine Kulturinstitution der Zukunft in Form bringt.
Podiumsdiskussion und digitales Symposium im Livestream
Die Vorstellung einer Architektur für ein neues Miteinander verbindet funktionelle und inhaltliche Ansprüche. Sie befragt sowohl etablierte institutionelle Raumkonzepte als auch Selbstverständnisse und plädiert für ein radikales Zusammendenken von Vermittlung und Forschung, von Partizipation und Kuration mit dem Ziel, wandelbare Räume für interdisziplinäre und teilhabeorientierte Programmarbeit im urbanen Raum zu schaffen.
Wie können veränderbare Räume für Diskurs und Teilhabe aussehen? Welche architektonische Sprache braucht es, um Recht und Rechtsstaat interdisziplinär und ohne Barrieren zu vermitteln? Wie bindet man zukünftige Besucher:innen und Nutzer:innen in den architektonischen Gestaltungsprozess ein und entwickelt nachhaltig einen lebendigen urbanen Ort? Das Symposium geht diesen und anderen Fragen in drei Themenschwerpunkten unter der Prämisse einer Architektur für ein neues Miteinander nach und knüpft dabei an den Ergebnissen des zweiten Impuls-Symposiums im Vorfeld der Stiftungsgründung an.
Podiumsdiskussion „Immaterielles Ausstellen und Vermitteln. Was bedeutet das für die Architektur?“
Wie wird Immaterielles architektonisch erlebbar? Und welche Räume braucht es zur Vermittlung von Recht und Rechtsstaatlichkeit, von Demokratie und Menschenrechten? Die öffentliche Auftaktdiskussion, am 13. Juli 2022, fragte nach neuen Bautypen für mehr Miteinander und Teilhabe, nach Methoden, die den urbanen Raum und seine Nutzer:innen in den Entwicklungsprozess einbeziehen und nach Raumkonzepten, die interdisziplinäre Programmarbeit fördern.
Es diskutierten Dr. Dieter Bogner (Universitätsdozent, Museumsplaner und Ausstellungskurator), Prof. Holger Kleine (Hochschule RheinMain), Dr. Ulrike Lorenz (Klassik Stiftung Weimar) und Prof.‘in Dr. Karen van den Berg (Zeppelin Universität Friedrichshafen).
Moderation: Katharina Stahlhoven (Bundesstiftung Baukultur)
Grußwort und Einführung: Henrike Claussen (Stiftung Forum Recht)
Hybrides Symposium „Beyond the Museum. Architektur für ein Neues Miteinander“
Form Follows Function revisited
Veränderbare Räume für kulturelle und politische Bildung
Verschiedene Ansätze der zeitgenössischen Museums-, Bildungs- und Performance-Architektur testen die Grenzen traditioneller Raumkonzepte sowie die mit ihnen verbundenen institutionellen Selbstverständnisse. Welche Eigenschaften zeichnen sie als Orte aus? Welche Räume braucht es zur Vermittlung demokratischer Praxis? Und wie könnte der mit der Stiftung verknüpfte Forumsgedanke in eine (ver-)wandelbare (Innen-) Architektur übersetzt werden?
Architektur und Urbanität
Demokratische Erscheinungsformen in der Stadt von heute
Mit den Neubauten der Stiftung Forum Recht entstehen interaktive Kulturbauten zur Vermittlung von Recht und Rechtsstaat. Was bedeutet dies für die Entwicklung einer „demokratischen“ Formensprache? Was können Neubauten in bestehenden und neu zu errichtenden städtischen Quartieren, im Hinblick auf innovative urbane Architekturkonzepte, bewirken? Welches Potential kann Architektur als Seismograf und Impulsgeberin für gesellschaftspolitische Aushandlungsprozesse entfalten?
Raum für Teilhabe
Partizipation und Inklusion in Bauprojekten
Die Stiftung Forum Recht hat den Auftrag in einem auf Bürgerbeteiligung angelegten Forum mit ihren Angeboten alle gesellschaftlichen Gruppen zu erreichen. Was bedeutet dies für den Prozess der Raumkonzeption und der Entwurfsplanung ihrer Neubauten? Welche Wirkung entfalten innovative Methoden und Ansätze der Partizipation in Bauprojekten? Und welche Rolle kann Partizipation auch bei der konzeptionellen und strukturellen Entwicklung zukunftsfähiger hybrider Räume spielen?
Programm
14. Juli 2022
10:00 Uhr
Begrüßung und Einführung zum Symposium
Dr. Stephan N. Barthelmess, Stiftung Forum Recht
10:15 Uhr
Impulse
Museumsbauten zwischen
Repräsentation und Aneignung
Prof.’in Dr. Karen van den Berg, Zeppelin Universität Friedrichshafen
Karen van den Berg ist seit 2003 Inhaberin Lehrstuhls für Kunsttheorie & inszenatorische Praxis an der Zeppelin Universität und seit 2006 akademische Leiterin des artsprogram ebendort. Sie studierte Kunstwissenschaft, klassische Archäologie und Nordische Philologie in Saarbrücken und Basel, wo sie 1995 promovierte. Lehre und Gastaufenthalte führten sie u.a. an die an der Universität Witten/Herdecke, die Chinati Foundation in Texas, an die Stanford University sowie an das IKKM der Bauhaus Universität Weimar. Van den Bergs Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Kunst und Politik; sozial engagierte Kunst; Theorie und Geschichte des Ausstellens; Bildungsarchitektur und Studioforschung.
Bild: Lorenz Widmaier
Architekturen der Aufführungskünste:
Aktivierte und Aktivierende Räume
Prof.’in Dr. Annette Menting,
HTWK Leipzig
Annette Menting ist Architekturhistorikerin und –kritikerin. Nach dem Architekturstudium an der Universität der Künste Berlin war sie im Architekturbüro von Hinrich Baller und von Gerkan, Marg und Partner tätig. 1997 Promotion bei Jonas Geist an der UdK Berlin zum Werk von Paul G. R. Baumgarten. DFG-Habilitanden-Stipendium für die Forschung zum Gesamtwerk von Max Taut. Seit 2000 ist sie Professorin für Architekturgeschichte und –kritik an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig. Mitgliedschaften: Sächsische Akademie der Künste, Bund Deutscher Architekten, Arbeitskreis für Theorie und Lehre der Denkmalpflege, Deutsches Nationalkomitee von ICOMOS und Jurymitglied bei Architekturwettbewerben. Forschungen und Publikation zur Architekturgeschichte der Moderne, Denkmalpflege und zeitgenössischen Baukultur. Seit 2016 leitet sie gemeinsam mit Barbara Büscher das DFG-Forschungsprojekt „Architektur und Raum für die Aufführungskünste“, das sich seit Sommer 2021 in der zweiten Förderphase bis 2024 befindet.
Bild: Fotografie Margret Hoppe
Salons der Republik: Räume für
demokratische Aushandlungspraxis
Prof. Holger Kleine,
Hochschule RheinMain
Holger Kleine ist Architekt in Berlin und Professor in Wiesbaden. Forschungsgebiet öffentliche Innenräume. Architekt u. a. der Deutschen Botschaft in Warschau. Autor der Bücher Neue Moscheen und Raumdramaturgie. Kurator von My Home is my Parcel (DAM 2020) und Die Salons der Republik (DAM / JOVIS 2021). Sein Projekt Talking Station 1 wurde auf der Architektur-Biennale 2021 in Venedig und in New York ausgestellt. Derzeit Arbeit an einem Projekt über Marcel Proust.
Bild: Holger Kleine
Transfer
lab.bode und Haus Bastian:
Flexible Raumkonzepte für kulturelle
und politische Bildung in der Praxis
Heike Kropff,
Staatliche Museen zu Berlin
Heike Kropff ist seit August 2013 Leiterin der Abteilung Bildung / Kommunikation der Staatlichen Museen zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Von 2008 bis 2013 verantwortete sie als Kuratorin für Bildung und Vermittlung diesen Aufgabenbereich im Museum Folkwang, Essen. Von 2005 bis 2008 leitete sie die Kunstvermittlung im Westfälischen Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster sowie die Vermittlungsarbeit der Großausstellung skulptur projekte münster 07. Zuvor war sie an verschiedenen Institutionen tätig, z.B. der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn, dem Museumsdienst Köln, der Kunstsammlung Nordrhein Westfalen in Düsseldorf und dem Museum Ludwig in Köln. Sie ist seit 2008 mit Lehraufträgen an verschiedenen Universitäten betraut, z.B. der Technischen Universität Berlin, der Freien Universität Berlin, der Ruhr Universität Bochum, der Universität Hamburg und der Karlshochschule International University, Karlsruhe. Von 1997 bis 2004 betrieb sie einen freien Ausstellungsraum in Köln.
Bild: Heike Kropff
Forum Groningen: Creating a Third
Space with innovative Programming
and Contemporary Architecture
[Vortrag in Englischer Sprache]
Hans Poll,
Forum Groningen
Referent: Hans Poll, Forum Groningen
Director Programming & Marketing des Forum Groningen
Bild: Hans Poll
13:15 Uhr
Impulse
Architektur, Soziales und Demokratie.
Soziologische Perspektiven
Prof. Dr. Thomas Schmidt-Lux, Universität Leipzig
Thomas Schmidt-Lux ist Professor für Kultursoziologie am Institut für Kulturwissenschaften der Universität Leipzig. Er interessiert sich für Architektur, Städte, Recht und Gewalt sowie qualitative Methoden. Derzeit forscht er zur Architektur des Digitalen und zu Lost Cities im Oman.
Bild: Simon Reinhardt
Was macht Räume demokratisch?
Prof. Dr. Jan-Werner Müller, Princeton University
Jan-Werner Mueller ist Professor für Politische Theorie in Princeton sowie Fellow am New Institute, Hamburg. Er studierte an der Freien Universität Berlin, dem University College London, dem St. Antony’s College Oxford und der Princeton University. Von 1996 bis 2003 war er Fellow am All Souls College, Oxford; von 2003 bis 2005 war er Fellow in Modern European Thought am European Studies Centre, St. Antony’s College.
Bild: Princeton University
Das Forum als Idee, Vision und
Konflikt. Kunst- und architekturhistorische
Perspektiven.
Prof.’in Dr. Brigitte Sölch,
Universität Heidelberg
Brigitte Sölch, Professorin für Architektur- und Neuere Kunstgeschichte an der Uni Heidelberg, lehrte zuvor an der Kunstakademie Stuttgart. Sie war langjährige Mitarbeiterin und Co-Projektleiterin am Kunsthistorischen Max-Planck-Institut in Florenz und habilitierte sich an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sölch ist Mitbegründerin des DFG-Netzwerks Wege – Methoden – Kritiken: Kunsthistorikerinnen 1880–1970 sowie Mitherausgeberin der Zeitschrift für Kunstgeschichte.
Bild: Brigitte Sölch
Transfer
Öffentliche Räume als Sozialverdichtungsapparate und Schmiermittel der Gesellschaft
Prof.’in Dipl.-Ing. Isabel Maria Finkenberger,
FH Aachen
Isabel Maria Finkenberger ist Freie Stadtplanerin AKBW, Inhaberin von STUDIO if+. Büro für Stadtplanung und räumliche Transformation in Köln und Professorin für Grundlagen der Stadtplanung, urbane Transformation und innovative Prozessgestaltung an der FH Aachen. Mit ihrem interdisziplinären Netzwerk arbeitet sie in Praxis, Forschung und Lehre an Fragestellungen gemeinwohlorientierter Stadtentwicklung und räumlicher Transformation und zur Schnittstelle von Stadtplanung, künstlerischen Praktiken und Kulturinstitutionen.
Bild: Isabel Maria Finkenberger
15:30 Uhr
Impulse
Demokratische Planungs und Baukultur
MA Dipl. Ing. Fee Kyriakopoulos,
Die Baupiloten BDA
Fee Kyriakopoulos ist Diplom-Ingenieurin der Architektur im Büro die Baupiloten (BDA) mit dem Fokus auf partizipative Raumpraxis im Zusammenhang von Bildungsbauten und gemeinschaftlichen Wohnformen. Ab dem WiSe 2022 lehrt Sie an der Universität Coburg zum Thema „Partizipative Raumpraxis“.
Bild: Fee Kyriakopoulos
Citizen Science & Digital.Labore –
co-kreative Beteiligungsprozesse
für die Städte von morgen
Dipl. Ing. Steffen Braun,
Fraunhofer IAO Stuttgart
Dipl.-Ing. Steffen Braun ist Mitglied des Direktoriums und Leiter des Forschungsbereichs „Stadtsystem-Gestaltung“ am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in Stuttgart. Er ist Mitglied in mehreren Expertengremien, Beiräten und Arbeitsgruppen zu Smart Cities, Kunst im öffentlichen Raum, urbanem Leichtbau sowie der Morgenstadt-Initiative. Steffen Braun studierte 2003-2009 Architektur und Stadtplanung an der Universität Stuttgart.
Bild: Steffen Braun
Partizipation an der Schwelle
von analogen und digitalen
Räumen der Zukunft
Christoph Deeg,
Berater in den Bereichen Digitale Transformation und Playful Participation
Christoph Deeg beschreibt sich selbst als „Gestalter des digital-analogen Lebensraums“. Er berät national und international tätige Organisationen, Institutionen und Unternehmen in den Bereichen Digitale Transformation, Transformative Gamification und Playful Participation. Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Entwicklung neuer Kultur-, Bildungs- und Arbeitsorte als digital-analoge Erfahrungsräume mit dem Fokus auf Interaktion und Partizipation.
Bild: Christoph Deeg
Das Programm zum Symposium finden Sie hier als PDF zum Download.